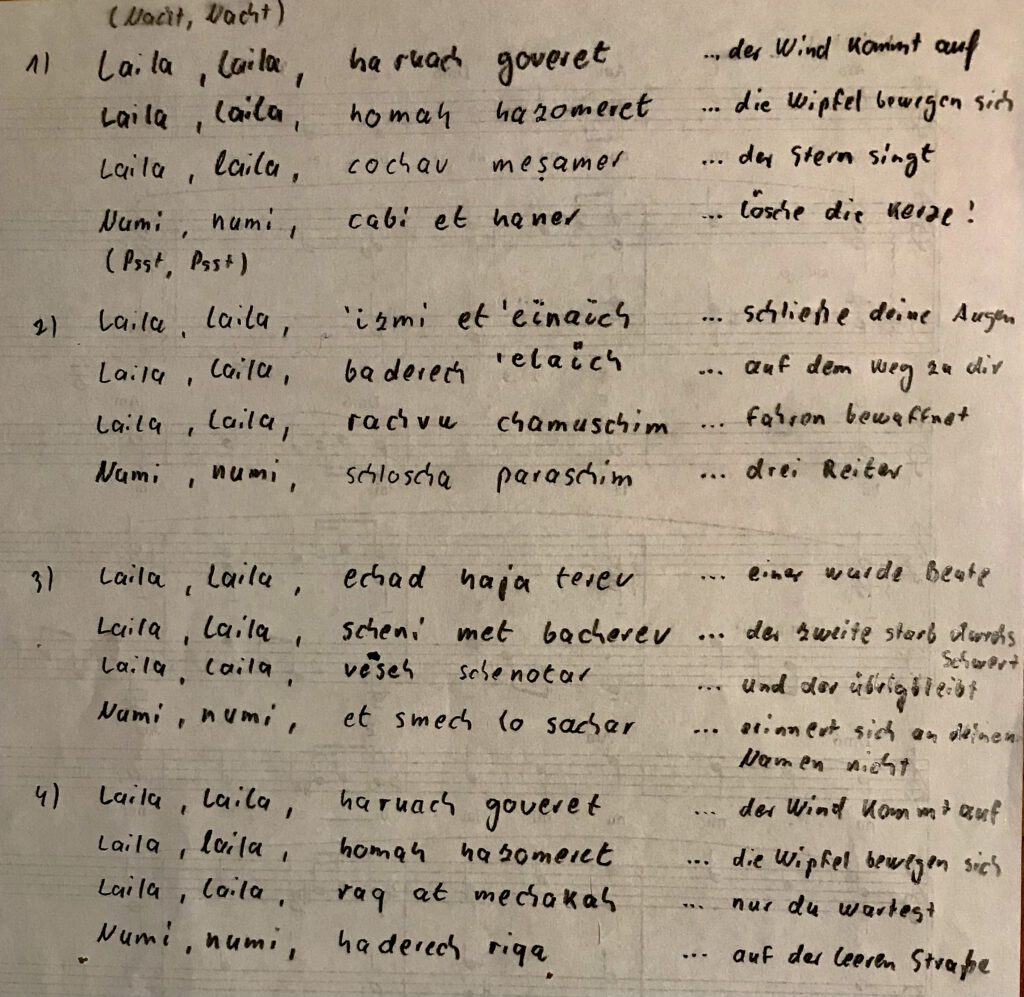…samt den Schwellen, den engen Fenstern und den drei Umgängen ringsumher; und es war Tafelwerk allenthalben herum.
Hes 41,16
Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 2017.
Unverständliches verstehen
Hesekiel beschreibt etwas, das niemand als er selbst je gesehen hat: den Neuen Tempel, wie er im Reich Gottes stehen wird. Hesekiel beschreibt dieses Reich Gottes vom Tempel ausgehend. Er wird von einem Boten Gottes durch den Tempel geführt, der Bote nimmt vor seinen Augen überall Maß, damit Hesekiel sich diese Maße notieren kann. Und es scheint, als würde Hesekiel dabei so konkret wie nur immer möglich.
Wenn der gezogene Vers ein Fragment ist, stelle ich ihn auch im Zusammenhang ein, meist mit der Lutherübersetzung 2017, die leichter verständlich ist als die alte Übersetzung von 1912. Wie sie sich mit dem Link oben selbst überzeugen können, unterscheidet sich i vorliegenden Fall die neue Übersetzung erheblich von der alten. In solchen Fällen greife ich als erstes zu der für das Alte Testament zuverlässigen und texttreuen katholischen Einheitsübersetzung, hier ein Link. Zu meiner Überraschung ist dort die Wiedergabe der alten Lutherübersetzung ähnlicher als der neuen. Ich schaue auf den hebräischen Urtext — der Text strotzt vor bautechnischen Termini und ich kann ihn auch mit einer Interlinearübersetzung nicht wirklich lesen.
Was ist hier geschehen? Die Einheitsübersetzung gibt Hinweise. Viele Verse in Kapitel 41 tragen Fußnoten, man sei an dieser Stelle in der Übersetzung der Septuaginta (der antiken griechischen Übersetzung der jüdischen Schriften) gefolgt, weil der überlieferte hebräische Text nicht verständlich sei. Die Worte „waren getäfelt…“ zu Beginn von Vers 16 in der Einheitsübersetzung und der neuen Lutherbibel sind zum Beispiel der Septuaginta entnommen. Für den Folgevers 17 schreibt die Einheitsübersetzung schlicht: „Text unklar.“
Es scheint, als habe der Überlieferungsvorgang beim dutzend-, vielleicht hundertfach wiederholten Abschreiben den Text von Kap 41 so weit zerstört, dass der Inhalt nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann. Weil den Neuen Tempel niemand kennt, waren Fehler schwer zu sehen und zu korrigieren. Die großen Übersetzungen gehen unterschiedlich weit darin, den überlieferten hebräischen Text durch besser verständliche alte Übersetzungen zu stützen — wobei unklar ist, ob sich die antiken Übersetzer nicht schon demselben Problem ausgesetzt sahen.
Ist das tragisch? Ja und nein. Hier wird der Tempel im Reich Gottes beschrieben, in der neuen Welt, auf die Juden wie Christen warten, und wir verstehen die Beschreibung nicht! Aber vielleicht tritt hier auch etwas sehr Grundsätzliches zutage. Wenn Sie Kapitel 40 und 41 lesen, dann werden Sie erstaunt sein über die Fülle von Details, die genauen Maße überall. Es wirkt auf den ersten Blick, als sei der Text ein Plan, und man könne den Neuen Tempel damit bauen. Aber der Eindruck täuscht. Wenn Sie versuchen, sich das Beschriebene vorzustellen, werden Sie feststellen, dass es nicht gelingt — zu oft setzt der Prophet ein Vorwissen des Lesers, das dieser nicht haben kann. Man muß wissen, wie der Tempel aussieht, um ihn sich vorstellen zu können…!
Hesekiel kennt den alten, den salomonischen Tempel genau: er war als junger Priester darin ausgebildet worden. Vielleicht bezieht er sich einfach auf die (beim Leser als bekannt vorausgesetzte) Grundstruktur des alten Tempels? Aber als er schrieb, war der Tempel schon viele Jahre lang zerstört. Am Anfang von Kapitel 40 datiert er seine Vision auf das vierzehnte Jahr nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier. Und die Menschen, für die er schrieb, waren bereits im ersten Exil nach Babylon gelangt, also noch einmal zehn Jahre zuvor. Nur die Alten unter ihnen konnten den Tempel noch gesehen haben. Einen Bauplan müsste Hesekiel für eine solche Leserschaft anders schreiben.
Man muss den Tempel des Reichs Gottes kennen, um ihn nach dem Text bauen zu können… Und mir will scheinen, als sei dies oft in der Bibel so. Ein hermeneutischer Zirkel: ohne Vorwissen um die Bedeutung erschließt sie sich nicht. Dieses Wissen mag aus der religiösen Tradition kommen, oder Gott selbst muß helfen. Sola scriptura, sagt Luther — aber die Heilige Schrift allein führt in ein Spiegelkabinett. Das ist eine schwierige Erkenntnis, auch und gerade mit Blick auf das Projekt dieses Blogs.
Gott selbst könnte den Tempel bauen, Hesekiels Text sagt nichts darüber, wie er entsteht. Man kann es aber auch so lesen: es kommt eine Zeit, in der Menschen wissen, wie der neue Tempel zu bauen ist. Für einen Propheten eigentlich keine ungewöhnliche Vorstellung. Hesekiels Vision wäre dann ein Vorgriff, und würde helfen, den Plan zu erkennen, wenn er ausgeführt werden kann.
Vielleicht also das: Wir brauchen Vertrauen in unsere Fähigkeit, das Entscheidende zu sehen, das Entscheidende zu tun, wenn die Zeit dafür reif ist. Christen erkennen darin den Heiligen Geist.
Ich will Ihnen zum Ende die Übersetzung von Rosenzweig und Buber anbieten. Sie ist sehr wörtlich und gibt den zerklüfteten Charakter des hebräischen Texts ungeschminkt wieder. Auch sie interpretiert natürlich, so sind etwa alle Satzzeichen Hinzufügungen, es gibt sie im hebräischen Quelltext nicht. Lesen Sie und verzichten Sie für diesmal auf ein genaues Verständnis. Vielleicht können Sie durch die Worte hindurch doch einen kleinen Blick in das Innere der Halle des Neuen Tempels werfen:
Und er maß die Länge des Gebäudes vor dem Abgetrennten, das an seiner Hinterseite ist, und seine Altane hüben und drüben: hundert Ellen. Und die Halle, und das Innere, und die Flursäle des Hofs, die Schwellen und die abgeblendeten Fenster und die Altane rings an den dreien, gegenüber der Schwelle Holzgetäfel rings ringsum, und der Boden, und bis zu den Fenstern [die Fenster aber gedeckt], bis über dem Einlaß und bis ins innere Haus und nach außen, und an der Wand überall, rings ringsum, im Innern und im Äußern, nach Maßen, da wars gemacht: Cheruben und Palmen – je eine Palme zwischen Cherub und Cherub, und der Cherub hat der Antlitze zwei, ein Menschenantlitz nach der Palme hüben und ein Löwenantlitz nach der Palme drüben – , gemacht an all dem Haus rings ringsum, vom Boden bis über dem Einlaß sind die Cheruben und die Palmen gemacht an der Wand. (Hes 41,15-20)
Die Reihe von Palmen und zwiegesichtigen Cheruben ringsum sehe ich jedenfalls klar vor mir. Vielleicht weil ich ähnliches kenne: das babylonische Ischtar-Tor im Berliner Pergamon-Museum. Und ich wünsche uns eine gesegnete Woche, mit Einsicht zur rechten Zeit, am rechten Ort…
Ulf von Kalckreuth