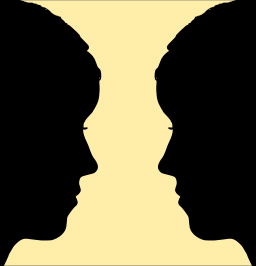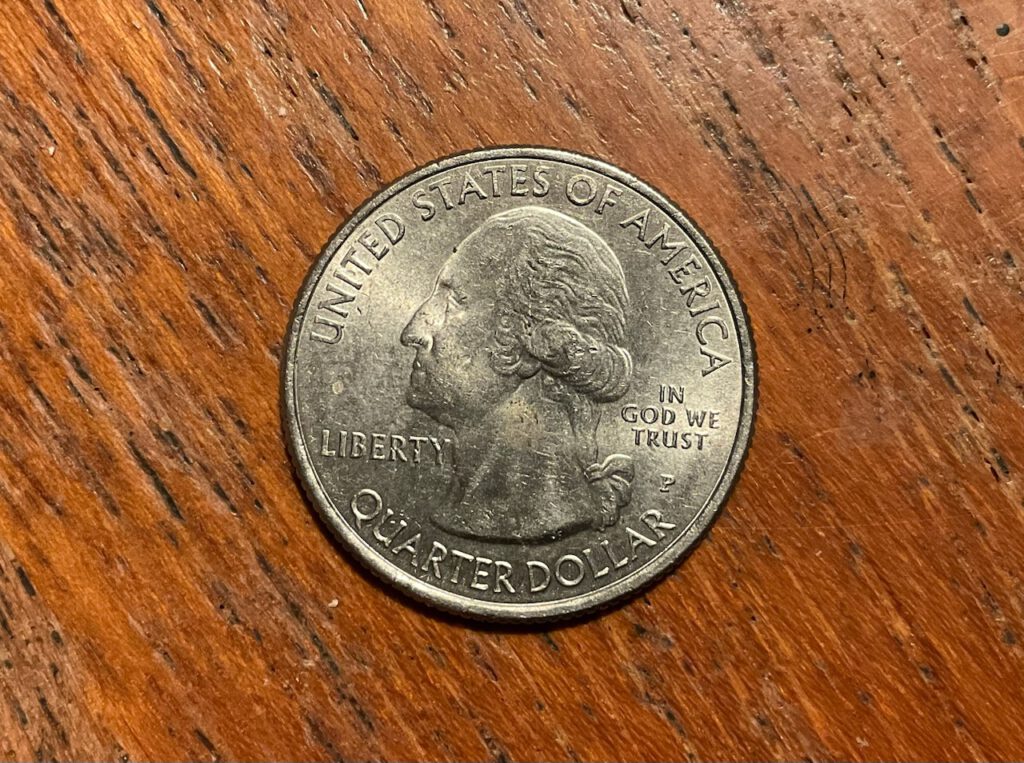Also kam Salomo von der Höhe, die zu Gibeon war, von der Hütte des Stifts, gen Jerusalem und regierte über Israel.
2 Ch 1,13
Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.
Worauf es ankommt, Teil II
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Wunsch frei. Einen einzigen. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Salomo opfert dem Herrn öffentlich auf der Höhe zu Gibeon, und in der Nacht darauf erscheint ihm der Herr und sagt ihm, er möge einen Wunsch äußern.
Ein wenig wie im Märchen. Was soll Salomo sich wünschen? Er ist das uneheliche Kind Davids mit Batseba, einer verheirateten Frau, deren Mann sein Vater hatte töten lassen. Um den Thron besteigen zu können, hat er sich aus einer hinteren Position gegen seine vielen Brüder durchgesetzt, auch gewaltsam. Seine Macht ist nicht gefestigt. Da wäre der Tod der Feinde als Wunsch naheliegend, auch Macht und Reichtum, um sich durchsetzen zu können. Aber Salomo wünscht sich etwas, das nicht auf der Hand liegt: Weisheit und Erkenntnis. Sehr zum Erstaunen des Herrn:
Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum noch um Gut noch um Ehre noch um deiner Feinde Tod noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. (2 Chr 1,11+12)
Ich sehe hier zweierlei. Manchmal schenkt Gott Dinge, um die wir nicht gebeten haben. Wenn wir hadern, dass das Leben die Erfüllung unserer Wünsche hartnäckig verweigert, mögen wir schauen, was da ist, ohne dass wir es uns gewünscht haben — Freundschaften, Erlebnisse, Musik, vielleicht ein wacher Geist oder die Freude an einem schönen und kraftvollen Körper. Wenn ich hinschaue, so ist meine Welt voll solcher Dinge.
Zweitens und spezifischer: Salomos Wunsch nach Weisheit ist ein weiser Wunsch. Könige haben ein spezielles Problem. Man ist König nur weil und solange andere sich nicht trauen, die Gefolgschaft zu versagen oder sich aufzulehnen. Ein König hat keine nennenswerte eigene Kraft, seine Kraft ist geliehen von anderen. Deren Schwert muß er einsetzen. Auf das eigene Schwert zurückgeworfen lebt er nicht lange. Die anderen sind stärker, wenn sie sich zusammentun, immer! Die Kräfteverhältnisse zu durchschauen, mit stets wachem Auge, das Gewicht zu verlagern, um das Gleichgewicht zu wahren und nicht abzustürzen, Erwartungen aufzubauen, Phantasien, Ängste und Träume anderer zu nähren, zu richten, zu steuern, dazu ist Erkenntnis und Weisheit nötig. Für Königtum ist das ist die Grundlage. So ausgerüstet steigt Salomo herab von der Höhe Gibeon, um Israel zu regieren. Und so kommt auch das andere, Reichtum, Macht und Ehre — und viele Frauen.
Der Vers der vergangenen Woche gab Anlass nachzudenken, worauf es ankommt im Leben. Und ich hatte gefragt, ob in der Aufzählung des Psalms etwas fehlt. Hier ist eine gute Antwort: Weisheit und Erkenntnis. Weisheit und Erkenntnis bergen indes manchmal Wahrheiten, denen man sich eigentlich gern entziehen würde. Vielleicht deshalb ist der Wunsch Salomos nicht universell. Aber am Ende wird die Wahrheit uns frei machen, sagt Joh 8,32. Daran habe ich stets geglaubt und tue es noch.
Der Herr verleihe uns Weisheit und Erkenntnis!
Ulf von Kalckreuth