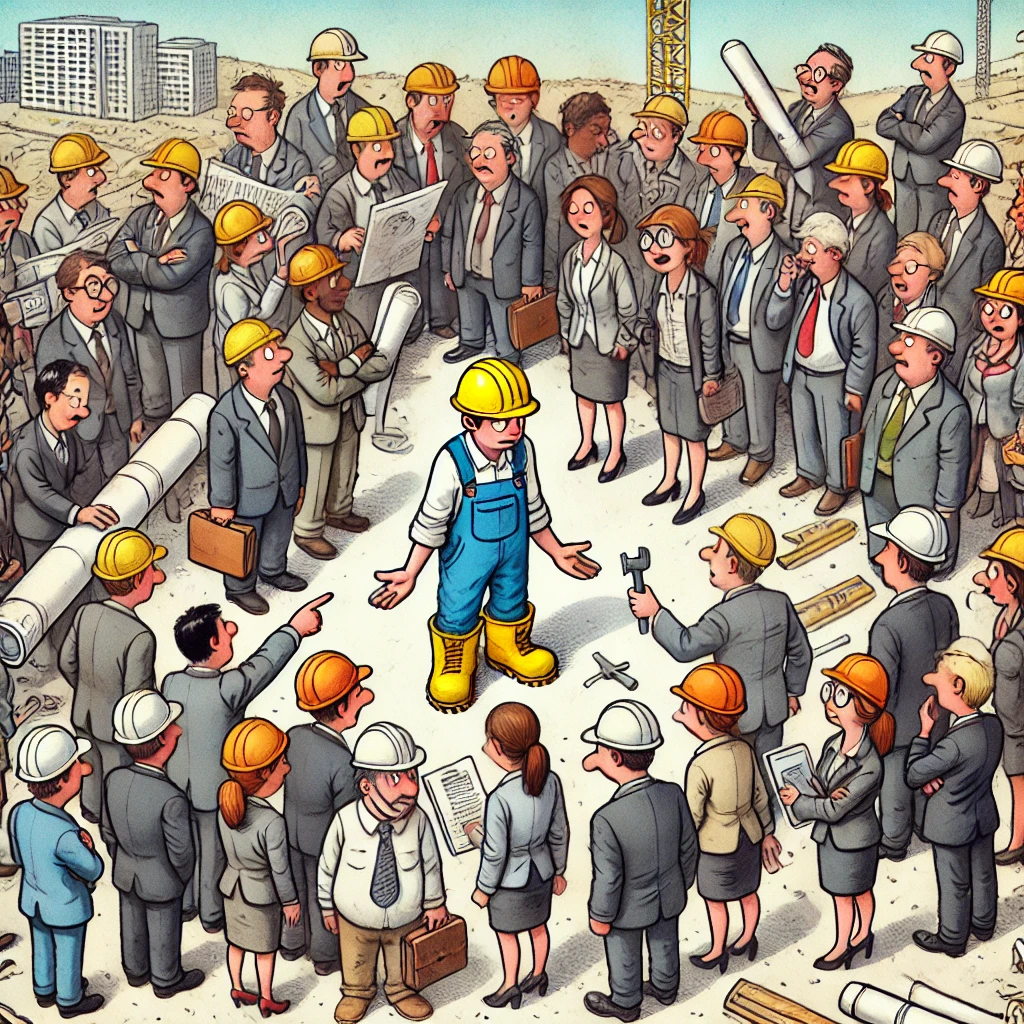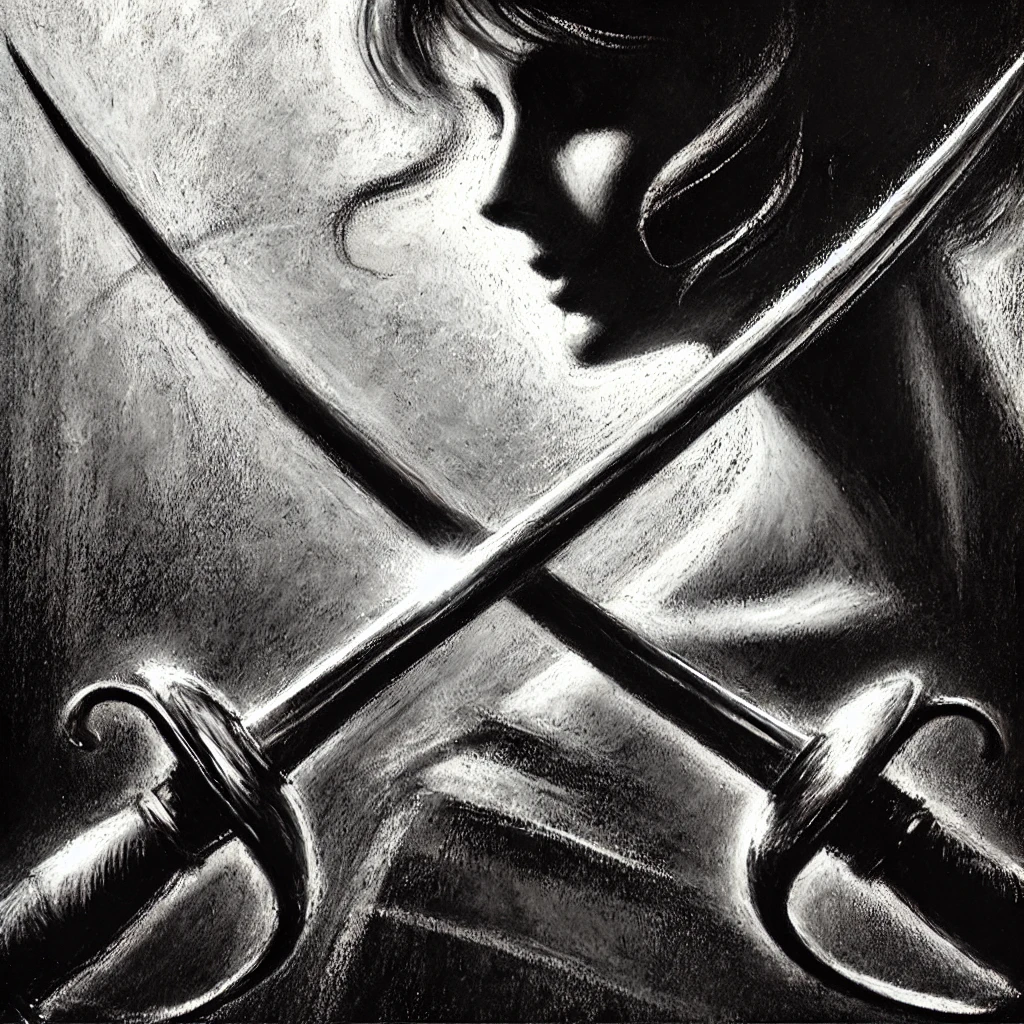Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Joh 4,24
Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.
Geist und Wahrheit
Jesus ist auf der Durchreise, von Judäa in sein Heimatland Galiläa im Norden. Dabei durchquert er Samarien, das Herzland des alten Nordstaats Israel. Dieser Staat wurde vor Zeiten zerstört, die Einwohner großenteils verschleppt. Aber immer noch wird in Samarien Gott der Herr angebetet. Für die Juden ist der Kult der Samariter auf dem Berg Garizim illegitim. Nur der Tempel in Jerusalem ist Anbetungs- und Opferstätte. Siehe hierzu den BdW 14/2021
Am Brunnen trifft Jesus auf eine samaritische Frau. Sie sind allein, die Jünger sind ins Dorf gegangen, Brot zu holen. Sie reden.
Die Frau spricht an, dass die Juden Glauben und Anbetung der Samariter nicht für rechtens halten. Nicht, etwa, weil Jesus das nicht wüsste, sondern weil es zwischen ihnen steht, mehr noch als der Umstand, dass er Mann ist und sie Frau.
Jesus antwortet: ja, so ist es. Das Heil wird von den Juden kommen, sie kennen Gott, und die Samariter nicht. Aber es kommt die Zeit und sie ist schon da, sagt er, dass die Samariter weder auf dem Garizim noch in Jerusalem den Herrn anbeten werden. Die wahren Anbeter nämlich werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das wird wiederholt, in unserem Vers, weil es so wichtig ist: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Jesus hält dabei die Schrift hoch, die den Kult der Samariter verdammt. Zwischen den Zeilen sagt er aber, dass auch Samariter wahre Anbeter sein können und sein werden. Der institutionalisierte Opferkult der Juden in Jerusalem ist nicht wahre Anbetung. Wahre Anbetung vollzieht sich im Geist und in der Wahrheit.
Der Satz ist schön. Ich habe aber Mühe damit, denn ich weiss nicht genau, was er bedeutet. Der Kontext macht deutlich, dass wahre Anbetung nicht an einem bestimmten Ort und durch bestimmte, dazu ausgebildete und legitimierte Personen nach festen Regeln vollzogen wird. Gott ist Geist, und der Geist ist überall. Was aber bedeutet es positiv?
In der Wahrheit anbeten, im Geist anbeten… Aus unserem Geist heraus, aus unserer Wahrheit? Es gibt acht Milliarden mal den menschlichen Geist und acht Milliarden Wahrheiten, die sich ständig ändern. Die eine Wahrheit, den einen Geist gibt es nur in Gott. Jesus meint, dass wir Gott aus Gottes Geist heraus anbeten sollen. Dazu muß er in uns sein, dazu muß er in uns wirken.
Wie geht das? Ich bin Lobpreismusiker, und eigentlich sollte ich es ganz genau wissen… In dieser Woche habe ich es immer wieder versucht — Gott aus Gottes Geist heraus anzubeten. Was ich dann finde, ist vor allem mein eigener Geist, meine unerfüllten Bedürfnisse und mein Versagen.
Aber ich habe doch etwas entdeckt. Als ihn seine Jünger bitten, sie das Beten zu lehren, gibt ihnen Jesus das Vaterunser. Gehen Sie es im Kopf einmal durch. Die ersten drei Bitten nach der Anrufung beschreiben Gottes vollkommene Präsenz in der Welt: „Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe“. Man kann das in sich selbst nachvollziehen, ganz langsam. Erst dann wechselt die Perspektive hin zum Betenden und das Gebet kulminiert in der Bitte, dass die Verbindung zu Gott erhalten bleiben möge, trotz aller Sünde, durch Vergebung und Erlösung. Am Ende kehrt das Gebet zurück zu Gott: „Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen“
Das hilft sehr. Vielleicht ist der Vers eine Aufforderung, sich ins Unsagbare vorzutasten und eigene Wege zu finden. Wenn es den einen, allgemeinen Weg gäbe, hätten wir eine Liturgie, und die soll es ja nicht sein.
Im Geist und in der Wahrheit. Jesu Gespräch mit der Frau am Brunnen steht jenseits von Zeit und Raum. Ich wünsche uns in dieser Woche Berührung: unserer Wahrheit mit Gottes Wahrheit, unseres Geistes mit Gottes Geist. Was wird dann geschehen?
Ulf von Kalckreuth