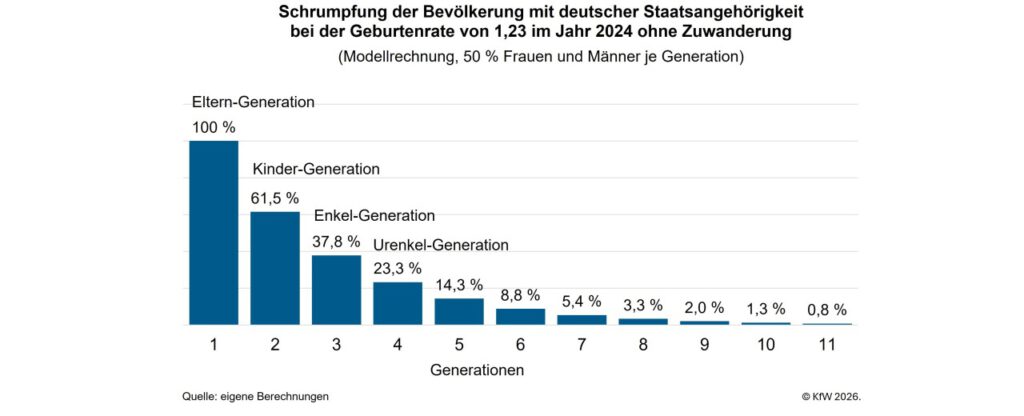Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Ps 43,1
Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984
Lifehack
Wie vor zwei Wochen: der erste Vers eines Psalms. Wenn man hinschaut, so ist es wohl nicht immer der erste Vers gewesen. Die Psalmen 42 und 43 gehören zusammen, ein Psalm wie ein modernes Lied, mit Strophen und Refrain. Psalm 43 ist die dritte Strophe mit abschließendem Refrain.
Ausgangspunkt ist die vollkommene Verzweiflung. Der Betende wird der feindlichen Welt um ihn nicht mehr Herr. Er ertrinkt, die Fluten rauschen über ihn (Ps 42), den bösen Menschen ist er hilflos ausgeliefert. In unserem Vers ruft er den Herrn an, eingeleitet mit einem trotzigen „Richte mich!“ Die Bitte kulminiert in den Worten:
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Der Betende ist nicht angekommen im sicheren Hafen, nein, aber er stellt es sich vor, er sieht es vor sich. Er glaubt und hofft. Und dann kommt der den Psalmen gemeinsame Refrain:
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Eine durchaus bemerkenswerte Struktur: Der Betende wartet. Er dankt nicht, aber er antizipiert den Dank, fast so, als gäbe es schon Grund dazu: „Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken…“ Das ist wie Medizin, die Seele wird ruhig. Beklemmung und Lähmung weichen.
Als ich ein Kind war, erzählte mir mein Vater eine Geschichte, der eine oder andere kennt sie vielleicht: Zwei Frösche auf der Suche nach Nahrung fielen in einen großen Krug voll Milch. Die Wand des Krugs war glatt, die Frösche konnten nicht klettern, und springen konnten sie aus der Flüssigkeit heraus auch nicht. Sie paddelten, dann gab einer der Frösche auf: „Es hat keinen Sinn, stundenlang ums Leben zu kämpfen, wenn man am Ende doch ertrinkt!“, und der ertrank in der Milch. Der andere Frosch paddelte weiter, bis an die Grenze seiner Kraft. So bildete sich in der Milch ein Butterklumpen. Dieser trug ihn und er konnte aus dem Krug springen.
Die Kunst besteht darin, die Seele zur Ruhe zu bringen, OBWOHL in der Welt nichts darauf hindeutet, dass sich die Lage bessern oder lösen könnte. Das geht nicht ohne geerdeten Glauben – Glaube und Hoffnung gehen hier eine innige Verbindung ein. Sie werden unmittelbar wirksam: die von ihrer Unruhe befreite Seele wird Wege finden. Der Teufelskreis aus der Übermächtigkeit der „Feinde“ und der eigener Machtlosigkeit ist gebrochen.
Der Lifehack eines Menschen auf seinem Weg mit Gott durchs Leben. Kann ich gut gebrauchen!
Ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche, mit einem Gruß aus Schlüchtern,
Ulf von Kalckreuth