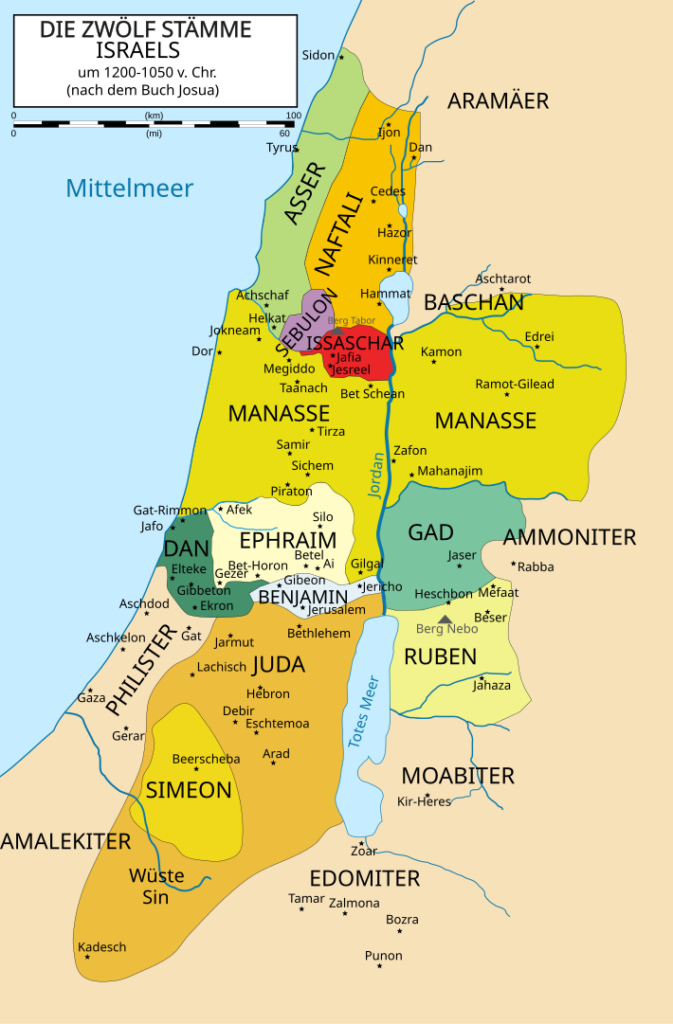…nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden!
1 Petr 1,2
Hier ist ein Link für den Kontext des Verses, zur Lutherbibel 1984.
Ein Neujahrsgruß von Petrus
Dies ist der Vers für die erste Woche des neuen Jahres, die auch die letzten Tage des alten noch enthält, und so freue ich mich sehr, dass es ein Gruß und Segenswunsch ist!
Hier der Vers im Kontext mit dem Beginn des Satzes, er steht ganz am Anfang des Petrusbriefs (V1+2 in der Übersetzung von 1984):
Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden!
Petrus richtet diesen Brief an eine offene Mehrzahl nichtjüdischer Christen im östlichen Mittelmeerraum. Ausgangspunkt und Leitmotiv ist die Erwartung des nahen Endes der Welt, wie wir sie kennen. Petrus gibt keine konkrete Weisung, der Brief wirbt vielmehr für eine der Endzeit angemessene Haltung: Bescheidenheit, Pflichterfüllung, Demut, Gehorsam, Geduld, Liebe und freudige Erwartung.
Der Vers enthält die schwierige Vokabel „Blut“. Jemanden oder etwas mit Blut besprengen (Link) gehört als symbolische Handlung zu den jüdischen Opferriten vor der Zerstörung des Tempels. Besprengung ist verknüpft mit Reinigung und Heiligung, der Darbringung von Opfern und der Bestätigung eines Bundes. Alle diese Funktionen sind hier angesprochen: Jesu Opfertod, sagt Petrus, reinigt und heiligt seine Nachfolger und er richtet den Bund zwischen Gott und den Menschen neu auf. Die von Gott ausersehenen, mit dem Blut Jesu besprengten Angesprochenen stehen in einer heiligen Gemeinschaft: untereinander und mit Gott.
Viel Holz für einen Halbsatz…
Wie am Anfang, so steht auch am Schluß des Briefs ein Friedensgruß: Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.
So sei es! Ich wünsche uns allen ein frohes neues Jahr in Gottes Segen,
Ulf von Kalckreuth